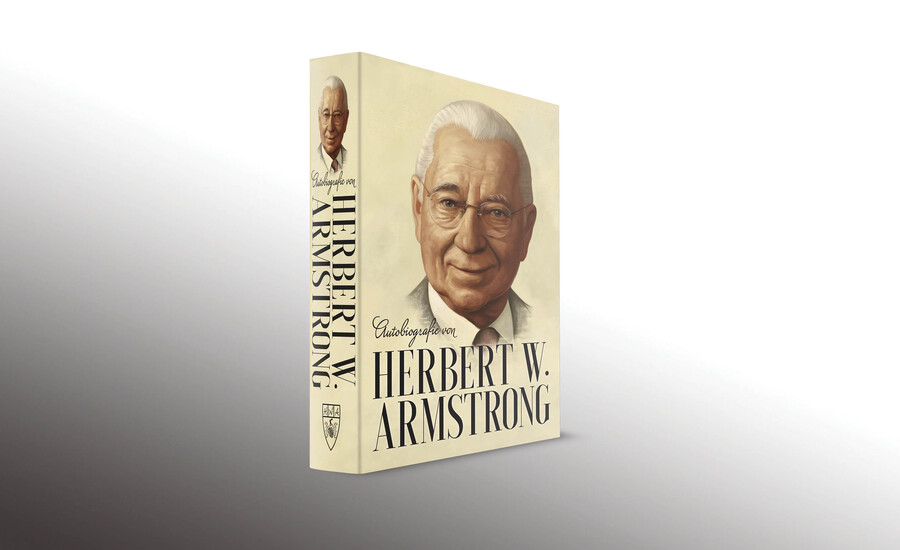
die poSAUNE
Unsere erste Reise ins Ausland
Fortgesetzt von „Eine neue Art von College in den USA und in Europa!“
Es war der Morgen des 14. Februar 1947. In diesem Moment fuhr der Shasta Limited in den Bahnhof von Eugene, Oregon, ein.
Frau Armstrong, Frau Annie Mann (eine spätere Betreuerin von Mädchenwohnheimen am College in Pasadena) und ich waren in meinem Büro. Ich hatte Hut und Mantel an, meinen Koffer gepackt neben mir stehen und war dabei, die letzten Papiere in meine Aktentasche zu werfen.
Plötzlich rief Frau Armstrong aus: „Ich habe beschlossen, dass ich mit dir gehen will!“
Frau Armstrongs „Hemdzipfelschießen“

„Nun, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu entscheiden“, sagte ich. „Du kannst dich jetzt unmöglich rechtzeitig fertig machen.“
„Oh ja, ich kann!“, antwortete sie. „Nimm deinen Koffer und deine Schreibmaschine und lass es uns schnell machen!“
Wir rannten zum Aufzug. Unten auf der Straße wartete einer unserer Söhne am Steuer des Wagens.
„Fahr rüber zu unseren Zimmern! Beeil dich!“ sagte ich. „Mutter hat beschlossen, mit mir zu gehen.“
Damals, so wird sich der Leser erinnern, wohnten wir in zwei Zimmern im Obergeschoss eines Wohnhauses, das etwa fünf oder sechs Blocks vom Büro entfernt war. Wir hatten unser Haus fast zwei Jahre zuvor verkauft. Das Werk hatte das Geld gebraucht.
Wir wurden, wie nur ein 17-jähriger Junge ein Auto auf zwei Rädern um die Ecke bringen kann, zu unserem Wohnheim gefahren. Wir rannten die Treppe hinauf. Frau Armstrong warf zuerst ihren Koffer aus dem Schrank und bat Frau Mann, ihre Kleider hineinzuwerfen, während sie sie von den Bügeln herunterzog und buchstäblich aus dem Schrank warf. In weniger als zwei Minuten hatte sie Kleider, Anzüge und andere Dinge aus den Schubladen geholt und in ihren Koffer geworfen.
Wir rasten wieder nach unten, und der Wagen fuhr um die Kurven und erreichte das Depot etwa eine Minute vor der Abfahrt des Zuges. Eugene war ein Teilungspunkt der Eisenbahn, und der Zug blieb dort 10 Minuten, während sie die Lokomotiven und das Personal wechselten. Aber der Zug fuhr genau in dem Moment in den Bahnhof ein, als wir den Aufzug des Bürogebäudes herunterkamen.
Ich sagte meinen Söhnen, sie sollten unser Gepäck in den Zug laden, während ich über den Boden des Wartesaals zum Fahrkartenschalter eilte und um eine einfache Fahrkarte nach Portland bat. Jetzt war keine Zeit mehr, um Fahrkarten nach New York und zurück für meine Frau zu besorgen.
Viele, viele Male hatte ich das gemacht, was meine Frau als „Hemdzipfelschießen“ für Züge bezeichnete. Dieses eine Mal war sie selbst schuldig.
Aber das „Hemdzipfelschießen“ war noch nicht vorbei. Ich musste nun ihr Hin- und Rückflugticket nach New York abholen, als wir in Portland umstiegen. Wir hatten 12 Minuten Zeit zwischen den Zügen in Portland. Aber, wie damals üblich, stand vor jedem Fahrkartenschalter eine lange Schlange. In allerletzter Sekunde bekam ich schließlich ihre Fahrkarten und erwischte den Zug, als er gerade losfuhr.
Wir kamen am Nachmittag in Seattle an und traten am Abend die lange Fahrt von Seattle aus an. Es war eine raue, ruckelige Fahrt durch die Staaten Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Minnesota und Wisconsin bis nach Illinois bei Chicago. Unser Liegeplatz im Pullman befand sich wohl an einem Ende des Wagens, direkt über den Rädern, wo die Fahrt viel ruppiger ist. Auf der nächtlichen Fahrt der B & O nach Washington, D.C., war es noch rauer.
Wie Sie Ihre Auslandsreise nicht planen sollten
Nun folgte eine Reihe von aufregenden Ereignissen, die dem Leser ein Beispiel dafür geben, wie man seine Auslandsreise nicht planen sollte.
Als wir am Morgen in Washington ankamen, checkten wir zunächst im Statler Hotel ein. Bevor wir unsere Pässe beantragen konnten, mussten wir Passfotos von uns machen lassen. Wir fanden im Hotel ein führendes Fotostudio. Der Fotograf versuchte, uns neben den Passbildern auch ein Dutzend größerer Fotos zu verkaufen.
Ich hatte mich seit vielen Jahren nicht mehr fotografieren lassen. Ich hatte nie zugelassen, dass mein Bild in der Plain Truth oder in unserer Literatur abgebildet wurde. Jahrelang war ich sogar allen Kameraaufnahmen ausgewichen und hatte sie vermieden, mit Ausnahme einiger weniger, die im Familienkreis bleiben sollten. Doch kurz zuvor hatte ich einen Brief von einem Radiohörer erhalten, der mich davon überzeugte, dass ich mich geirrt hatte.
Dieser Zuhörer fragte mich, was ich zu verbergen hätte. Er fragte mich, was ich von einem Prediger halten würde, wenn ich in seiner Kirche vorbeikäme und der Prediger sich hinter der Kanzel versteckte, während er predigte. Würde ich nicht denken, er hätte etwas zu verbergen? Würde ich nicht misstrauisch werden? Er sagte, der Charakter stehe einem ins Gesicht geschrieben, und er wolle immer die Gesichter derer sehen, denen er zuhöre. Natürlich sei dies im Radio nicht möglich, aber zumindest, so sagte er, sollte ich den Zuhörern mein Bild zeigen.
Ich kam auf die Idee, eines dieser Fotos für einen Nachdruck zu verwenden, aber ich zögerte noch, es in der Plain Truth abzudrucken. Der Fotograf machte mir einen Vorschlag. Warum nicht eine Großbestellung über 500 Stück aufgeben? Er würde uns einen besonders günstigen Preis für eine solche Bestellung machen. Er mache das ständig, sagte er, für Kongressabgeordnete und Regierungsbeamte, die diese Fotos dann an ihre Wählerschaft schickten.
Da kam mir der Gedanke, dass es vielleicht besser wäre, echte Fotos nur an die wenigen zu schicken, die sie persönlich angefordert und gewünscht hatten, als mein Bild für alle Leser zu veröffentlichen. Wir bestellten, glaube ich, etwa 400 Fotos von mir und 100 von Frau Armstrong, denn die meisten Anfragen, die wir erhalten hatten, galten natürlich mir. Ich glaube, wir fanden später heraus, dass wir sie genau andersherum hätten bestellen sollen, denn die Nachfrage nach dem Bild meiner Frau war weitaus größer als das Angebot. Nach unserer Rückkehr aus dem Ausland wurden sie an diejenigen verschickt, die sie persönlich angefordert hatten.
Als nächstes ging ich zum Außenministerium, aber der Pressesprecher war bis zum Nachmittag nicht zu sprechen. Dann ging ich zum Fahrkartenschalter der Cunard Line, der Reederei des großen Schiffes Queen Elizabeth. Sie hatten auf dieser Fahrt noch eine Kabine für zwei Personen in der Kabinenklasse, aber das war der einzige Platz auf dem Schiff. Wir wollten Mitte März zurückkehren. Aber auf der Reise in Richtung Westen war bis August kein Platz mehr frei. Man sagte mir, dass es in den nächsten zwei Tagen vor der Abfahrt vielleicht noch eine Chance auf eine Stornierung geben könnte. Der Agent erklärte sich bereit, das New Yorker Büro anzurufen, und ich konnte mich dort nach meiner Ankunft in New York melden. Ich kaufte das Ticket für die Kabine auf der Ostpassage.
Am Nachmittag wartete ich lange im Büro des Pressesprechers des Außenministeriums, bis er gegen 16:30 Uhr zurückkehrte. Er war froh, mich wiederzusehen, und rief sofort das Passamt auf der anderen Straßenseite an und bat darum, meinen Pass sofort zu bearbeiten. Es war kurz vor Feierabend, als wir im Passamt ankamen.
Sie sagten mir, dass unsere Pässe am Morgen fertig sein würden. Ich zeigte ihnen zufällig meine Beglaubigungskarte des State Department, die ich bei mir trug.
„Hätten Sie uns das gezeigt“, wurde mir gesagt, „hätten wir Ihre Pässe schon früher am Tag ausgestellt, und Sie hätten sie jetzt schon haben können.“
Für die Durchquerung Frankreichs, die Einreise in die Schweiz und die Einreise nach England mussten Visa eingeholt werden.
Am nächsten Morgen, dem 18. Februar, besuchten wir, nachdem wir die Pässe erhalten hatten, sowohl die schweizerische als auch die französische Botschaft und ließen ihre Visa in die Pässe stempeln. Wir erfuhren jedoch, dass das britische Visum in New York eingeholt werden musste.
An diesem Nachmittag hatten wir eine weitere sehr harte Fahrt mit dem Zug nach New York – härter als die anderen zuvor.
Als wir in New York ankamen, gingen wir zum Ambassador Hotel, in dem ich üblicherweise abstieg, wenn ich in New York war. Ich hatte am Tag vor meiner Abreise aus Eugene telegrafiert, um eine Reservierung vorzunehmen. Aber selbst da war mein Telegramm nicht rechtzeitig angekommen. Das Hotel war völlig ausgebucht.
„Herr Armstrong“, sagte der Rezeptionist, „wir versuchen natürlich, uns um unsere Stammgäste zu kümmern, aber wir sind einfach ausgebucht, und zwar für etwa zwei Wochen. Aber wir haben für Sie und Frau Armstrong ein Zimmer in einem anderen sehr guten Hotel nur ein paar Blocks entfernt reserviert. Wir waren auch nicht in der Lage, Ihren Senator der Vereinigten Staaten von Oregon unterzubringen. Sie werden sehen, dass Senator Wayne Morse dort drüben in der Lobby sitzt.“
Ich war mit Senator Morse bekannt. Er war vor seiner Wahl in den Senat Dekan der juristischen Fakultät der Universität von Oregon in Eugene gewesen. Frau Armstrong und ich gingen durch die Lobby, unterhielten uns kurz mit dem Senator und gingen dann weiter zum anderen Hotel.
Unmittelbar nachdem wir unser Zimmer erreicht hatten, rief ich bei der Cunard-Linie an, um mich zu erkundigen, ob die Rückreise am 15. März von Southampton aus storniert worden war.
„Herr Armstrong“, sagte der Mann im Cunard-Büro, „ich würde sagen, dass Ihre Chancen absolut hoffnungslos sind. Wir sind für alle unsere Schiffe – und auch für alle anderen Dampferlinien – bis Mitte August voll ausgebucht. Mehr noch, wir haben mehrere hundert andere auf der Warteliste – alle vor Ihnen. Es ist absolut unwahrscheinlich, dass es so viele Stornierungen gibt, dass wir die Plätze vor der morgigen Abfahrt alle besetzen können.“
Hoffnungslos oder nicht, ich gebe nicht so schnell auf. Ich beschloss, am nächsten Morgen erneut im Cunard-Büro anzurufen.
Aber lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass all diese Erfahrungen ein Beispiel dafür sind, wie man eine Auslandsreise nicht planen sollte – und zwar nicht kurzfristig, ohne Pass-, Schiffs- oder Flugreservierung, Visa oder andere Vorbereitungen. Beginnen Sie mit der Planung mindestens einen Monat im Voraus.
Besser als John Bull
Am nächsten Morgen rief ich das Cunard-Büro erneut an. Es meldete sich dieselbe Stimme aus dem Reservierungsbüro. Es war die gleiche Geschichte.
„Ich habe Ihnen gesagt, Herr Armstrong, dass es keine Chance gibt“, sagte er.
Aber ich habe weiter geredet. Bald kamen wir in ein interessantes Gespräch. Ich erzählte ihm von einer Zweigschule in Europa. Die Idee war etwas Neues im Bildungswesen. Er war interessiert, und so erzählte ich weiter. Nach einer Weile sagte er: „Würden Sie mich einen Moment entschuldigen? Ich muss einen Anruf auf dem anderen Telefon entgegennehmen. Ich bin gleich wieder da.“
Nach nur etwa 50 Sekunden kam seine Stimme zurück.
„Unter welchem Glücksstern sind Sie geboren, Herr Armstrong?“, fragte er. „Das grenzt an ein Wunder! Wissen Sie, was das für ein Anruf war? Es war ein Mann, der eine Kabine für die Abfahrt am 15. März von Southampton storniert hat, und nur weil Sie gerade am Telefon sind, werde ich all die anderen Bewerber auf der Warteliste vor Ihnen vergessen und Ihnen die Kabine geben!“
Es war kein „Glücksstern“, aber wahrscheinlich war es ein Wunder! Frau Armstrong und ich liefen eilig zur nächsten U-Bahn-Station an der Lexington Avenue, nahmen den ersten Schnellzug zur Wall Street und eilten zum Cunard-Büro, wo wir unsere Rückfahrkarte für die Queen Elizabeth besorgten. Wir wussten, dass wir ohne diese Passage weder ein britisches Visum erhalten noch in der Nacht an Bord gehen konnten.
Die eigentliche Abfahrt war für etwa 5 Uhr morgens am nächsten Tag angesetzt, aber alle Passagiere mussten noch am selben Abend, Mittwoch, dem 19. Februar, bis 23 Uhr an Bord sein.
Sofort fuhren wir mit der U-Bahn zurück nach Uptown und begaben uns zur britischen Visastelle im Rockefeller Center an der 5th Avenue. Vor dem Visumschalter bildete sich eine Schlange. Ich wartete in der Schlange. Als ich endlich das Fenster erreichte, wurde mir gesagt, dass in weniger als 30 Tagen kein Visum ausgestellt werden könne. Ich könne meinen Antrag jetzt einreichen, aber das Visum könne erst in 30 Tagen ausgestellt werden.
„Aber ich muss dieses Visum sofort haben, heute!“ sagte ich. „Sehen Sie, hier ist unser Ticket für die Queen Elizabeth. Wir müssen vor 11 Uhr heute Abend an Bord sein.“
„Das macht keinen Unterschied, Sir“, antwortete der Beamte. „Wir brauchen 30 Tage, um ein Visum auszustellen. Ihr Amerikaner versucht immer, alles in aller Eile zu erledigen. Aber Sie sind jetzt in einem britischen Büro, und wir haben es nicht so eilig.
„Dies mag ein britisches Büro sein, aber Sie sind jetzt in Amerika, mein Herr“, gab ich zurück. „Und hier machen wir die Dinge auf amerikanische Art. Ich habe Tickets für die Queen Elizabeth, und wir werden sie heute Abend besteigen!“
„Mein lieber Herr“, sagte der Beamte höflich, „wir Briten sind sehr entschlossen, wissen Sie. Würden Sie jetzt bitte zur Seite gehen. Sie halten die Warteschlange auf.“
„Nun“, lächelte ich, „du magst Johnny Bull sein, und du magst Bulldoggen-Entschlossenheit und Sturheit haben, aber im Moment bin ich entschlossener. Ich werde mich nicht von hier wegbewegen, bevor Sie das Visum in meinem Pass abgestempelt haben. Wenn Sie für die, die hinter mir sind, Platz machen wollen, stempeln Sie es einfach hier ab.“
„Aber ich muss einfach den Weg für die anderen hinter Ihnen freimachen. Würden Sie dann mit einem der Beamten an einem der Schreibtische hinter mir weiterreden, damit ich zu den anderen gelangen kann?“
„Das kommt darauf an“, sagte ich. „Ist der Mann am Schalter hinter Ihnen Ihr Vorgesetzter? Hat er mehr Befugnisse, ein Visum auszustellen, als Sie?“
In der Gewissheit, dass er über eine höhere Autorität verfügte, erklärte ich mich bereit, das Fenster zu verlassen und mit dem Mann weiter oben zu sprechen, wenn der Beamte zum Fenster käme und mich zu ihm durch das Tor lassen würde.
Er fragte mich, warum ich meinen Antrag nicht 30 Tage früher eingereicht hatte. Ich erklärte ihm, dass es sich um eine Notfallreise handelte, die plötzlich nur sechs Tage zuvor an der Westküste geplant worden war. Ich erklärte ihm, dass wir unsere Pässe sozusagen auf der Flucht besorgt hatten und dass wie durch ein Wunder ein Platz auf dem Schiff frei geworden war und wir auch alle anderen erforderlichen Visa hatten. Jetzt brauchten wir nur noch das britische Visum, damit wir in Southampton landen und auf dem Weg in die Schweiz und zurück durch England reisen konnten.
Aber auch er war hartnäckig. Er weigerte sich, das Visum für weniger als 30 Tage auszustellen. Das erschien mir sehr ungerecht. Wenn er entschlossen war, war ich noch entschlossener. Ich redete weiter.
„Herr Armstrong“, sagte er schließlich, „ich muss Sie einfach bitten, mich zu entschuldigen. Ich habe viel Arbeit zu erledigen.“
„Ich werde nicht gehen, bevor Sie das Visum in unsere Pässe gestempelt haben“, sagte ich mit Nachdruck.
„Also gut“, kompromittierte er, „gehen Sie jetzt und kommen Sie heute Nachmittag um 15.30 Uhr wieder?“
Das Büro schloss um 16.00 Uhr.
„Versprichst du mir dann, dass du dich mit mir triffst, wenn ich es tue?“ fragte ich. Er versprach es, und Frau Armstrong und ich gingen. Pünktlich um 15:30 Uhr kehrten wir zurück. Aber dieser Mann vermied es, auch nur in unsere Richtung zu schauen. Ich stand am Tor und wartete. Er hielt sein Versprechen nicht ein. Er weigerte sich, auch nur einen Blick in meine Richtung zu werfen, und ich war nicht in der Lage, das Tor zu öffnen und zu ihm zu gehen.
Schließlich, fünf Minuten vor vier, ging er in einen anderen Raum. Einen Moment später sah mich ein anderer Mann, der an einem anderen Schreibtisch saß, nachdem er seinen Schreibtisch aufgeräumt hatte, um für den Tag zu gehen, an der Pforte warten. Er kam an die Pforte und fragte, ob ich noch etwas vor der Schließzeit haben wollte.
„Ja, in der Tat“, antwortete ich. „Herr Blank bat mich, um diese Zeit wegen meines Visums zurückzukehren. Wir gehen heute Abend an Bord der Queen Elizabeth. Aber Herr Blank ging einfach in ein anderes Zimmer und schien nicht zu wissen, dass ich hier war.“
„Oh, dann kümmere ich mich für ihn darum“, lächelte er. „Würden Sie bitte eintreten?“ Wir gingen zu seinem Schreibtisch, und er stempelte die Visa in unsere Pässe. Ich stieg schnell aus, bevor Herr Blank zurückkam.
Die schwimmende Stadt
Die Nerven lagen blank, als wir an diesem Abend gegen 9 Uhr die Gangway der Queen Elizabeth hinaufgingen und uns auf fünf ruhige Tage an Bord freuten.
Aber es gab keine Ruhe bis nach 23:00 Uhr, als alle Besucher das Schiff verlassen mussten. Die Briefe, die Frau Armstrong und ich unseren Kindern geschrieben haben, erzählen die Geschichte:
Mittwochabend, 23:39 Uhr.
19. Februar 1947
Hallo, Kinder!
Wir sind an Bord, die Post geht in 10 Minuten raus – wir müssen uns kurz fassen.
Die Besucher sind soeben abgereist. Dies ist das größte Passagierschiff, das je gebaut wurde – gewaltig! Es war wie eine übertriebene Filmpremiere – der Mob drängte sich auf allen 14 Decks – Block für Block – alle waren herausgeputzt – viele in Abendgarderobe – alle waren glücklich – die Menge um Mischa Auer, der Autogramme bekam (er fährt mit der Queen nach Europa) – jetzt wird es ruhiger. Dieses Schiff befördert 3500 Passagiere – eine schwimmende Stadt! Man verirrt sich auf ihr.
Endlich fahren wir wirklich nach England-Europa! Wir haben eine schöne kleine Privatkabine für uns allein.
Dick und Ted, beweist, dass ihr erwachsen seid und es wert seid, dass man euch vertraut und ihr Verantwortung übernehmt. Das ist der Weg zu mehr Privilegien. Ted, zieh dich warm an. Das ist die ganze Zeit, die ich habe.
Lassen Sie die Feuer zu Hause brennen. Es heißt, dass es in England und Europa keine Kohle für Feuer gibt. Wir werden wahrscheinlich erfrieren und verhungern – aber jetzt geht’s los!
Liebe,
Papa
Liebste Kinder, ihr alle,
Es ist ein Viertel vor Mitternacht. Wir sind an Bord und haben noch nicht viel vom Schiff gesehen. Es ist riesig. Wir gehen ins Bett.
Ted, wenn ich nur wüsste, dass du auf dich aufpasst, wäre ich viel glücklicher. Du darfst nicht im T-Shirt ausgehen, wenn du an einen Pullover gewöhnt bist. Und jetzt pass auf dich auf.
Ich kann es nicht fassen, dass ich endlich nach England fahre. Das wollte ich schon immer. Das ist ein schönes Schiff. Wir werden Fotos davon machen.
Wir wünschten, wir könnten euch alle sehen. Wir senden eine Welt voller Liebe an unsere liebe Familie.
Mutter
Die Queen Elizabeth war 314 Meter lang – 1/3 eines Kilometers. Sie hatte 14 Decks, ihre Bruttoraumzahl betrug 83673 Tonnen – etwa das Doppelte eines großen Schlachtschiffs – und sie konnte 3500 Passagiere befördern.
Ich war sehr amüsiert über einen Cockney, der an Bord des Schiffes einen Aufzug bediente. Natürlich gab es auf dem Schiff keine Aufzüge – die Briten nennen sie „Lifts“. Wenn er die verschiedenen Decks aufrief, sagte er immer: „Als nächstes das ‚C‘ deck –‚C‘ für Charlie.“ Dann: „Als nächstes Deck ‚R‘ – ‚R‘ für Restaurant.“ Dann: „‚B‘ als nächstes – ‚B‘ für Bertie.“ Dann: „‚I‘, als nächstes – ‚I’ für Albert.“
Wir hatten die reibungsloseste Überfahrt, die die Mitglieder der Besatzung je erlebt haben – so erzählten es uns einige von ihnen. Wir hatten dafür gebetet. Trotzdem verbrachte Frau Armstrong zwei Tage mit Seekrankheit im Bett.
An Bord des Schiffes, im Reservierungsbüro, wurde für uns ein Zimmer im Dorchester in London reserviert. In Southampton wartete der Schiffszug nach London im Zollschuppen am Hafen. Ich hatte eine Reservierung für einen Pullman-Wagen erhalten. Damit sind in England keine Schlafwagen gemeint, sondern nur Wagen der ersten Klasse. Die Tickets hatte ich am Reservierungsschalter an Bord des Schiffes erhalten. Im Zollschuppen prüfte ein Beamter unsere Tickets und sagte mir, dass wir in Wagen „I“ seien. Wir liefen also fast den ganzen Zug entlang, vorbei an den Wagen C, D und E bis hin zu I. Dann erfuhren wir, dass wir auf eine weiteren „Cockney“ (Londoner Dialekt) gestoßen waren, und wir mussten zurück zu Wagen „A“.
Ankunft in London
Wir legten am Dienstag, dem 25. Februar, in Southampton an. Am Donnerstagmorgen, dem 27. Februar, rief ein Reporter des Daily Graphic an und bat um ein Interview. Er kam um 12:30 Uhr an, und ich lud ihn zum Mittagessen in den Dorchester Grill Room ein. Die Idee eines Colleges mit einer Einheit in Amerika und einer in Europa, wobei eine Reihe von qualifizierten Studenten mit einem Stipendium von der einen zur anderen Einheit wechseln, war eine neue Idee im Bildungswesen.
„Eine wunderbare Idee“, rief er aus. Ich habe seinen Bericht in der Zeitung nicht mehr gesehen, da wir am nächsten Morgen früh zum Kontinent aufbrachen.
Unser erster richtiger Blick auf London war am Mittwochmorgen, dem 26. Februar. In mancherlei Hinsicht war es wie ein Traum. Für uns war es eine andere Welt. Einige unserer ersten Eindrücke haben wir in Briefen an unsere Kinder festgehalten. Hier sind kurze Auszüge daraus:
Von Frau Armstrong, geschrieben am Mittwoch: „Es ist so anders hier in London. Taxis, Busse, alles – ich habe noch nie eine solche Ansammlung von Gebäuden gesehen, so viele Kurven und Abzweigungen auf den Straßen. Wir waren heute im Somerset House. Ich wollte in Großmutters Geburtsurkunde nachsehen, aber ich konnte sie nicht finden. Allerdings weiß ich weder das Jahr noch den Ort ihrer Geburt. Wir haben ein schönes Zimmer, aber es ist kalt. Alle Lichter gehen aus, und die Aufzüge (pardon – „Lifts“) stehen von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr still. Kaum Wärme im kältesten Winter, den England seit 1840 hatte, also etwa zwei Jahre vor Großmutters Geburt. Heute schien die Sonne – das erste Mal seit fünf Wochen. Wir haben den Buckingham Palast, das Parlament usw. gesehen – natürlich nur einen sehr kleinen Teil von London, denn wir haben bis fast Mittag geschlafen.“
Wir waren erst nach Mitternacht in London angekommen.
Ein Teil meines Briefes, geschrieben am selben Tag: „Liebe Kinder, alle zu Hause: Wir haben unseren ersten Tag in der alten Stadt London verbracht. Wie Mutter euch erzählt hat, wurden wir wegen eines Streiks und wegen Kohlemangels bis gestern Abend um 19:30 Uhr an Bord der Queen Elizabeth festgehalten. Unser Zug fuhr erst um 21:00 Uhr ab. Wir haben fast gefroren. Wir frieren auch jetzt noch fast. Die Temperatur im Hotelzimmer und in der Lobby beträgt etwa 55 Grad. Es ist eine andere Welt. Alte Gebäude – viele in Ruinen, alle ursprünglich fast weiß und aus Stein, jetzt fast schwarz – Kohlenrauch.“
Teilnahme an einem königlichen Empfang
Kurz vor Mittag am Donnerstag erhielt ich einen Telefonanruf von der Privatsekretärin „Seiner Exzellenz, des außerordentlichen Botschafters und Bevollmächtigten von Saudi-Arabien, Scheich Hafiz Wabba“. Sie sagte, Seine Exzellenz habe gehört, dass ich in London sei – ich hatte auf der Konferenz in San Francisco 1945 ein einstündiges Gespräch mit ihm – und wolle Frau Armstrong und mich persönlich zu einem königlichen Empfang einladen, der am Abend im Ballsaal unseres Hotels, dem Dorchester, stattfinden sollte.
Ich fragte mich, woher der Scheich gewusst hatte, dass wir in London waren. Dann erinnerte ich mich, dass ich am Tag zuvor einige arabische Beamte in ihren wallenden Gewändern in der Lobby des Hotels gesehen hatte. Ich war zur Rezeption gegangen, um mich zu erkundigen, ob Scheich Hafiz Wabba im Hotel sei. Das war er nicht, aber man teilte mir mit, dass er häufig in das Hotel komme. Ich hatte erwähnt, dass ich ihn kenne. Ich nahm an, dass die Rezeption dem Scheich unsere Anwesenheit mitgeteilt hatte.
Dieser königliche Empfang fand zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit, des Kronprinzen Emir Saud, statt. Er wurde später König Saud von Saudi-Arabien. Der Sekretär des Scheichs sagte, Seine Exzellenz wolle sich noch einmal mit mir unterhalten, und dieser Empfang sei die einzige Gelegenheit dazu, da er am nächsten Morgen mit dem Kronprinzen abreisen würde.
Wir hatten geplant, London am Nachmittag in Richtung Zürich zu verlassen. Wir hatten eine Verabredung mit Dr. B. und Madame Helene Bieber in Zürich am selben Abend. Als ich mein Bedauern darüber ausdrückte, wegen dieses Termins in Zürich nicht teilnehmen zu können, drängte mich die Sekretärin, den Termin in Zürich zu verschieben und für den Empfang zu bleiben. Es sei das glamouröseste und wichtigste gesellschaftliche Ereignis, das in England seit dem Krieg stattgefunden habe, sagte sie und erinnerte mich daran, dass dies die einzige Gelegenheit für ein weiteres Gespräch mit dem Scheich sei.
Ich sagte, dass ich Dr. B. in Zürich anrufen würde, und wenn ich unseren Termin verschieben könnte, würde ich sie zurückrufen. Die Verabredung wurde verschoben, und ich benachrichtigte die Sekretärin des Botschafters. Wenig später traf eine speziell gravierte Einladung per Privatkurier in unserer Wohnung ein.
Vielleicht lassen sich die Erfahrungen am besten mit Auszügen aus einem Brief beschreiben, den ich unmittelbar nach der Rückkehr vom Empfang an die Familie zu Hause geschrieben habe. Dies ist, was ich schrieb:
„Soeben sind wir vom königlichen Empfang zurückgekehrt, den Scheich Hafiz Wabba und S.R.H. Emir Saud, der Kronprinz von Arabien, gegeben haben. Es war sehr bunt. Etwa 200 geladene Gäste – Admiräle, Herzöge mit ihren Monokeln und blinkenden Orden, Admirale, Kommodore, Dutzende von Botschaftern – wir sahen solche aus der Türkei, Chile, Albanien usw. Wir traten in Paaren ein. Ein Pagen in heller Uniform kündigte jedes Paar mit lauter Stimme an: „Herr und Frau so und so“, „Admiral und Frau so und so“, „Der türkische Botschafter“ und so weiter. Wir wurden als ‚Herr und Frau Herbert W. Armstrong‘ angekündigt.“
„Die Araber in ihren wallenden Gewändern standen in der Empfangsreihe. Zuerst ging Mutter vor, dann ich – denn das war der übliche Weg. Zuerst wurden wir von Seiner Exzellenz Scheich Hafiz Wabba begrüßt. Er stellte uns wiederum dem hochgewachsenen und sehr gut aussehenden Kronprinzen vor, den sie mit ‚Eure Königliche Hoheit‘ ansprachen. Dann folgten die übrigen fünf oder sechs arabischen Spitzenbeamten. Dann mischte sich die Menge unter die Gäste und aß kleine Sandwiches und französisches Gebäck, während ihnen Tee serviert wurde. Die Kleidung war nicht formell. Die Menschen hier haben einen Krieg hinter sich, wie wir Amerikaner es uns nicht vorstellen können, und sie haben einfach nicht viele schöne Kleider hier im Moment. Nur sehr wenige trugen Abendgarderobe. Die Kleider von einigen waren schon etwas abgenutzt. Doch die Edlen trugen ihre glitzernden Dekorationen. Mutter war die schönste Frau dort.“
„Wir hatten ein sehr nettes, kurzes, privates Gespräch mit dem Scheich und bekamen eine Stellungnahme für meinen Artikel über die Lage in Palästina für die nächste Plain Truth.“
„Wir saßen an einem Tisch, als sich die königliche Gesellschaft näherte. Sofort erhoben wir uns und setzten uns an einen anderen Tisch. Der Kronprinz setzte sich an den Tisch, den wir frei gemacht hatten, lächelte aber vorher und winkte uns, neben ihm am Tisch Platz zu nehmen. Er spricht kein einziges Wort Englisch. Ich war der Meinung, dass wir seine Einladung nicht annehmen sollten, da es offensichtlich war, dass der Tisch für die königliche Gesellschaft bestimmt war. Er wollte nur herzlich sein. Zweimal deutete er lächelnd an, uns zu begrüßen, aber ich schüttelte lächelnd und entschuldigend den Kopf und lehnte ab.“
Dieser Kronprinz wurde später König, als sein Vater, der alte König Ibn Saud, starb. Diese Erfahrung war das erste Mal, dass wir persönlich mit einem Königshaus in Kontakt kamen.
Während ich die obigen Zeilen schrieb, verfasste Frau Armstrong die folgenden Zeilen über den Empfang:
„Wir sind gerade vom königlichen Empfang in unser Zimmer zurückgekehrt. Ich fühlte mich wie der kleine Lord Fauntleroy. Es war alles so interessant. Wir wurden mit donnernder Stimme allen angekündigt. Wir wurden Scheich Hafiz Wabba (Seiner Exzellenz) vorgestellt, der uns wiederum dem Kronprinzen (Seiner Königlichen Hoheit) vorstellte, und so ging es weiter in der Empfangsreihe. Wir befanden uns unter den Lords und Ladies, Herzögen und Grafen, Admirälen und Botschaftern vieler Länder. Das sind alles ganz normale Leute. Wir waren so interessiert an allem – Tische überall – man konnte sitzen oder nicht. In der Mitte des Ballsaals standen große Banketttische mit verschiedenen Speisen und Getränken. Man konnte überall hingehen und sich selbst bedienen. Es gab wunderschöne Musik – Geigen und Klavier. Der palästinensische Ansager der dortigen bbc-Niederlassung stellte sich mir und dann zwei Damen vor, und ich stellte ihn später Papa vor.“
„Es ist jetzt der 1. März“ (dieser Teil wurde offensichtlich später geschrieben) „Ich habe alles gepackt. Wir fahren bald nach Frankreich. Es ist bitterkalt, in den Zimmern gibt es überhaupt keine Heizung. Ich fülle die Badewanne mit heißem Wasser und steige hinein, bis ich durchgewärmt bin, und springe dann ins Bett. Gestern Abend brachte mir das Zimmermädchen eine Wärmflasche aus Stein, die mich warm hielt. Das arme Großbritannien leidet anscheinend noch mehr als während des Krieges. Alles außer Wasser ist rationiert.“
Und nun der Kontinent
Am Abend des 1. März schrieb ich einen Brief mit meiner tragbaren Schreibmaschine auf dem Schoß in meinem oberen Abteil des Schlafwagens eines französischen Zuges, der von Calais nach Zürich fuhr. Frau Armstrong belegte das untere Abteil. Dies ist ein Teil von dem, was ich schrieb:
„Wir sind hier in Frankreich. Wir sind erst vor einer halben Stunde in diesen Zug gestiegen. Es ist jetzt dunkel. Heute Nachmittag um 4:30 Uhr befanden wir uns auf einem Schiff, das den Ärmelkanal überquerte, und die Sonne war noch nicht weit vom Horizont entfernt, als sie im Westen unterging. Ich schaute auf meine größere Uhr, die immer noch auf Eugene-Zeit eingestellt ist, und es war 8:30 Uhr. Ich rechnete kurz nach und stellte fest, dass Sie zu dieser Stunde dieselbe Sonne in derselben Entfernung vom Horizont im Osten aufgehen sehen, während wir sie im Westen untergehen sehen. Wir sind ein Drittel des Weges um die Erde von Ihnen entfernt. Mit anderen Worten: Ihr geht fast auf dem Kopf. Ich weiß, dass ihr das tut, denn einer von uns tut es, und das sind nicht wir hier.
„Calais ist eine ziemlich kleine Stadt. Wir haben viele zerbombte und zerstörte Gebäude gesehen. Das haben wahrscheinlich unsere Bomben verursacht. Die Nazis hatten diese Stadt. Es kommt mir seltsam vor, wie ein Traum, wenn ich daran denke, dass wir hier sind, wo der Krieg ausgetragen wurde, in einem Gebiet, das von den Deutschen besetzt war. Jetzt sehe ich hier keine Deutschen. Die Menschen hier sind Franzosen. Und ich meine Franzosen! Im Hafen und im Depot, die miteinander verbunden sind, tragen die Offiziere oder Bediensteten, oder was auch immer sie sind, typische französische Mützen, wie die Offiziere der französischen Armee, und wallende Umhänge. Die Träger, die eine Gelegenheit suchten, Gepäck für die Trinkgelder zu tragen, riefen: „Porteur! Porteur! Porteur!“ mit Betonung auf der letzten Silbe – oder gleich auf beiden. Die Zugträger können kein Wort Englisch. Sie sagen ‚Oui!‘.
„Es ist jetzt 20:45 Uhr. Gerade bei diesem letzten Absatz wurden wir zum Abendessen gerufen. Ein Franzose geht durch die Waggons und läutet eine niedliche kleine Glocke. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein Aufruf zum Abendessen war oder ob es überhaupt einen Speisewagen im Zug gab. Wir saßen im hinteren Wagen, also gingen wir vorwärts. Nachdem wir alle Schlafwagen und etwa vier Tageswagen (europäischer Typ, sechs pro Abteil) passiert hatten, kamen wir zu etwas, das wie der Gepäckwagen aussah, entschieden, dass es keinen Speisewagen gab und kehrten um. Zwei Wagen weiter hielt uns ein Portier an. Er konnte uns nicht verstehen, und wir konnten ihn nicht verstehen. Wir versuchten, ihm durch Bewegungen zu verstehen zu geben, dass wir den Speisewagen suchten – falls es einen gab. Mutter erinnerte sich plötzlich daran, dass das Wort ‚Café‘ ein französisches Wort ist, aber wahrscheinlich haben wir es nicht so ausgesprochen, wie es französisch ist – zumindest hat er es nicht verstanden. Ich deutete auf meinen Mund, dann auf meinen Bauch, und schließlich ging ihm ein Licht auf, und er lächelte. Er deutete wieder nach vorne. Wir öffneten die Tür des Gepäckwagens und stellten fest, dass es sich um einen Speisewagen handelte. Wir saßen neben zwei Engländern, von denen einer etwa alle zwei Wochen mit dieser Bahnlinie reist und Französisch spricht. Er lenkte uns durch das Essen. Zuerst kam ein Kellner und servierte etwas, das eine Suppe sein sollte (genau hier sagt Mutter, dass wir Amien betreten – diese Stadt spielte im Krieg eine wichtige Rolle, erinnern Sie sich?) Nach der Suppe kam ein anderer Kellner mit einem großen Teller Spaghetti, mit Fleischbällchen, die in gefüllten halben Eiern steckten. Es gibt kein Wasser – zum Trinken ungeeignet. Alle trinken Rotwein. Der Engländer sagte uns, wir könnten auch gebratenes Hähnchen haben, nicht schlecht, gegen Aufpreis, aber da hatten wir schon genug Spaghetti gegessen. Dann gab es Kartoffeln, dann „Eis“, das offenbar aus Wasser und Magermilch hergestellt wurde. Ich bezahlte mit englischem Geld, etwa 14 Schilling und ein paar Pence.
„Ich wünschte, Sie könnten diesen lustigen französischen Schlafwagen sehen. Diese französischen Waggons sind größer als die britischen – etwa so groß wie ein amerikanischer Waggon. Wir mussten eine steile Leiter hinaufklettern, um in den Zug zu gelangen. Verglichen mit unseren Pullmans ist er ziemlich primitiv, aber trotzdem nicht schlecht. Aber ganz anders. Das kommt uns komisch vor. Wir haben ein eigenes Abteil. Es gibt keine Abteile – alles Privatzimmer. Es hat ein eigenes Waschbecken, aber keine Toilette. Alle benutzen die gleiche öffentliche Toilette – Männer und Frauen.
„Mutter hat einige dieser französischen Bauernhöfe gesehen, von denen wir gehört haben – Haus und Stall für das Vieh in einem Gebäude. Der Boden ist mit Schnee bedeckt – und zwar überall, seit wir in Southampton gelandet sind. Wir werden gegen 8:10 Uhr in Basel ankommen. Es gibt keine Eisenbahnbroschüren, Fahrpläne oder Karten. Das ist ein Luxus, den nur Amerikaner genießen.“
Ich habe den Brief in einiger Ausführlichkeit zitiert. In den meisten Büchern oder Artikeln über Auslandsreisen werden viele dieser kleinen Dinge, die einem Amerikaner auf seiner ersten Auslandsreise auffallen, nicht erwähnt. Ich hatte das Gefühl, dass es für die Leser dieser Autobiografie interessant sein könnte.
Die Vision der Zukunft
Ein Teil eines Briefes, der am nächsten Morgen im Zug geschrieben wurde, mag interessant sein – und prophetisch: „Die Engländer sagen uns, dass wir Amerikaner gerade erst anfangen, die Entwicklungsstufe zu durchlaufen, die sie vor 200 Jahren durchlaufen haben – dass wir so weit hinter der Zeit zurückliegen. Sie glauben wirklich, dass sie uns voraus sind! Sie sind selbstgefällig dem voraus, wofür sie uns halten – dabei wissen sie eigentlich gar nichts über Amerika. Besonders beeindruckt war ich von ihrem Stolz. Sie glauben, dass sie allen Menschen auf der Erde moralisch überlegen sind. Dabei ist es ganz offensichtlich, dass ihre Moral seit dem Krieg auf einer Talfahrt ist! Sie sind sicherlich weit davon entfernt, ihre Sünden zu erkennen, national und individuell, und sie zu bereuen – und sie träumen nicht einmal davon und würden niemals glauben, dass sie bestraft und besiegt werden und dann von Christus bei Seiner Wiederkunft aus der Sklaverei befreit werden, um sie zur Erlösung zu bringen. In gewisser Weise weiß ich jetzt, dass ich sie warnen muss und werde, aber es wird schwierig sein, denn es gibt dort kein Radio, da es von der Regierung betrieben wird. Dennoch müssen sie gewarnt werden.“
„Ich denke, dass dies durch den Kauf von Werbeflächen in Zeitungen und Magazinen erreicht werden kann, indem man Leute dazu bringt, für die Plain Truth zu schreiben. Während ich in London war, habe ich Pläne für unsere kommende Kampagne gemacht, um England zu erreichen. Der Zeitungsreporter sagte, dass die Idee der Werbung genutzt werden könnte. Wir müssen die Plain Truth entweder nach England schicken oder in England drucken lassen, was wir zweifelsohne tun werden – eine europäische Ausgabe. Das College hier wird wahrscheinlich ein europäisches Hauptquartier werden, um unsere Arbeit in ganz Europa fortzuführen. Wir müssen Europa und England erreichen, ebenso wie Amerika! Unser Werk steht erst am Anfang! Ich verstehe immer mehr, warum wir einfach zu dieser Reise geführt wurden und warum sich der Weg auf so wundersame und plötzliche Weise an jeder Ecke vor uns auftat. Vor dem kommenden Atomkrieg haben wir noch viel Arbeit vor uns.“
Wie ich damals schrieb, hat sich die Prophezeiung erfüllt. Die Hochschule wurde einige Jahre später gegründet, als ich damals erwartet hatte – sie wurde in Bricket Wood bei London gegründet, statt in der Schweiz.
General Eisenhower und die Kanalinvasion
Am Donnerstag, dem 27. Februar, hatte ich unseren Kindern zu Hause Folgendes geschrieben: „Heute habe ich versucht, ein Paar Handschuhe zu kaufen. Es ist kalt, um den Gefrierpunkt, und in der bergigen Schweiz wird es noch kälter sein. Ich ging fast die ganze Bond Street entlang und hielt in allen Herrenbekleidungsgeschäften auf der rechten Seite der Straße in Richtung Norden und auf der Westseite der Straße auf dem Rückweg nach Süden zurück zum Piccadilly an. Im letzten Geschäft fand ich schließlich ein Paar dunkelbraune Ziegenhandschuhe. Ich verwickelte den Ladenbesitzer in ein Gespräch. Warum waren Handschuhe in einem so kalten Winter so rar?
„Er erklärte, dass ein großer Teil der in Großbritannien hergestellten Produkte exportiert wird. Ich fragte, warum. ‚Weil‘, antwortete der Kaufmann, ‚England sonst verhungern würde. Wir müssen fast alle unsere Lebensmittel importieren, und wir können keinen Kredit bekommen, der es uns ermöglicht, im Ausland Lebensmittel zu kaufen, wenn wir nicht den gleichen Wert an Industrieerzeugnissen in diese Länder exportieren. Handschuhe, Reisegepäck, Lederwaren, Porzellan, Wollwaren usw. „made in England“ kann man in den Vereinigten Staaten leichter kaufen als hier.“
„Nachdem ich endlich ein Geschäft gefunden hatte, das ein Paar hatte, bekam ich meine Handschuhe doch nicht. Nachdem er das Preisschild entfernt hatte, konnte er sie mir nicht geben, weil ich kein Rationsbuch hatte.“
„Heute Morgen haben wir in einem Obst- und Gemüseladen endlich ein paar Zitronen entdeckt. Meine Leber brauchte dringend Zitrussaft, nach der Art von Essen, die wir bekommen hatten. Vor dem Stand war eine lange Schlange gebildet worden. Nachdem ich 10 oder 15 Minuten in der Schlange gestanden hatte, fragte ich nach einem Dutzend Zitronen. Die Frau verlangte mein Rationsbuch. Keine Bezugsscheine, keine Zitronen – und dann nur ein halbes Pfund pro Kunde! Ich sterbe vor Hunger nach Obst, Säften und Blattgemüse. Sie wissen gar nicht, wofür wir an der amerikanischen Pazifikküste dankbar sein müssen. Wir haben von allem das Beste auf der Welt – und doch murren wir! Was wir hier sehen, ist das Zweitbeste. Jedem anderen Land (außer der Schweiz) geht es im Moment noch schlechter.“
„Als wir heute Abend die Lobby des Hotels verließen, erzählte uns der Portier, der eher wie ein beeindruckender, wichtiger Geschäftsmann aussieht, dass dieses Hotel (das Dorchester) vor der Invasion im Ärmelkanal das Hauptquartier von General Eisenhower war. Marshall, Patton, Bradley und all unsere Top-Generäle wohnten hier. Sie waren alle sehr beliebt. Dieser Portier sah viele von ihnen, sprach mit ihnen und arrangierte viele Dinge für sie. Er sagte, sie waren ruhig, aber strotzten nur so vor Persönlichkeit, und er schätzte Eisenhower als die fähigste, stärkste Persönlichkeit von allen ein, sogar noch vor Marshall, und hält ihn für einen der stärksten Männer der Welt ...“
„Wissen Sie, die Invasion im Ärmelkanal, die Deutschland besiegt hat, könnte genau in diesem Hotel geplant worden sein! Es könnte genau in diesem Zimmer gewesen sein, in dem ich gerade schreibe. Als die Nullstunde der Invasion kam, sagte der Portier, dass Eisenhower und alle anderen hochrangigen Militärs eines Morgens lächelnd und glücklich herunterkamen und sagten, sie würden sich zwei oder drei Tage auf dem Land erholen. Sie waren gute Schauspieler – sie wirkten glücklich. Sie sagten, sie könnten für ein paar Tage alle Hemmungen und die schwere Verantwortung abwerfen und sich die nötige Ruhe und einen Urlaub auf dem Land gönnen. Sie waren kein bisschen angespannt. Keiner schöpfte Verdacht. Sie checkten nicht aus dem Hotel aus. Sie ließen ihre Sachen in ihren Zimmern. Wenn irgendwelche Nazi-Spione im Hotel gewesen wären, wären sie völlig abgeschüttelt worden. Dann, am nächsten Morgen – peng! Die große Invasion war im Gange – und der Untergang für Hitler! Niemand in diesem Hotel ahnte, dass etwas im Gange war.“
Fortgesetzt in „Eindrücke aus der Schweiz und aus Frankreich“
